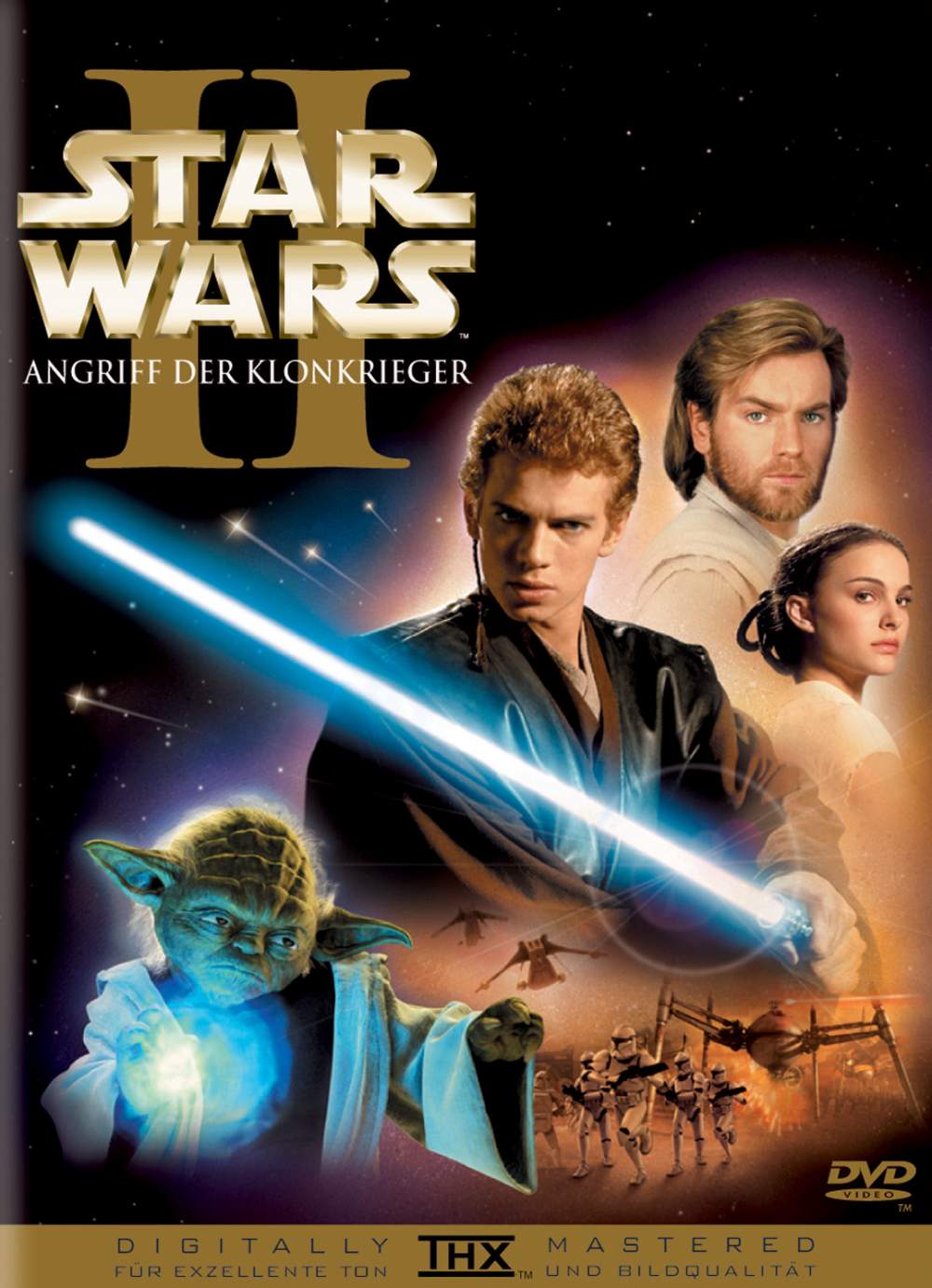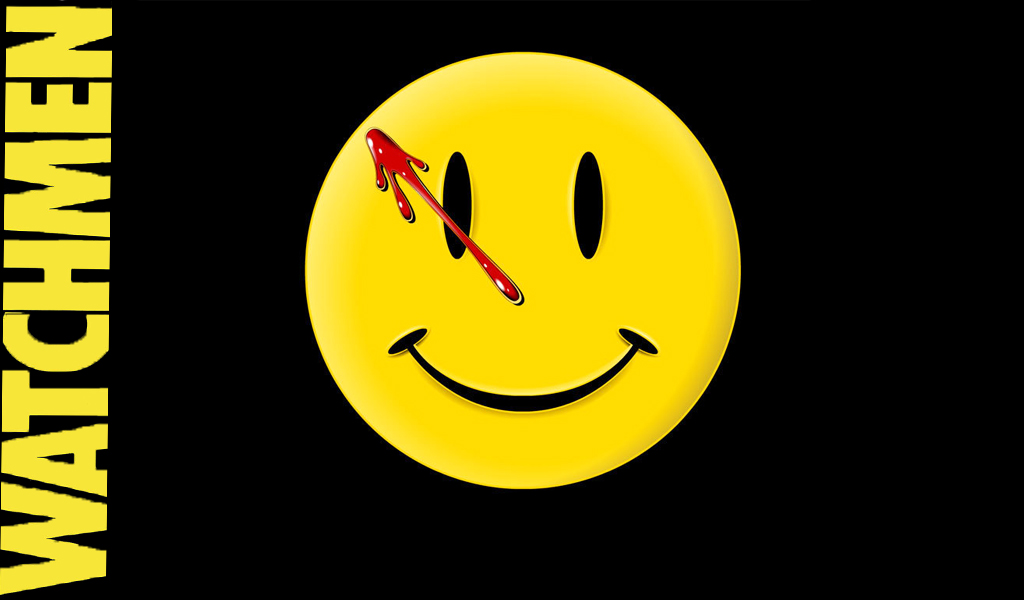Christopher Nolan weiß, wie man Filme bewirbt. Und mit „Inception“ hebt er dieses Können auf eine neue Stufe. Er wählt den Traum, so mysteriös und fremd, ummantelt ihn mit einer emotionalen Geschichte, packt ein paar bekannte Darsteller dazu – und manipuliert den Kinofan damit auf äußerst feinfühlige Weise. Nicht nur, dass das Schema anziehend auf den Filmliebhaber wirkt: Mit der Traumwelt entzieht er sich auch dem Zwang, groß rechtfertigen zu müssen. Denn was Krudes, Lachhaftes, Idiotisches in den Träumen eines jeden vorfällt, dürfte man zur Genüge erfahren haben. Und seitdem die erste Hypebombe in Form eines seltsamen Trailers mit sich drehenden Hotelfluren und auf faltenden Straßen einschlug, gab es von Seiten der 5. Gewalt kein Halten mehr. Man schoss mit Superlativen durch die Luft und krönte Nolans neueste Schöpfung als hyperintelligentes Erlöserkino in Zeiten der explosionssüchtigen Roboklopper – eine Begeisterung, so gewaltig, das gerne einmal alles, was wenigstens einen Hauch mit Objektivität zu tun hat, mit einem kräftigen Kinnhaken zu Boden schlug. Auf die über alles hinwegsehende Internetmaschinerie folgte die kräftige Unterstützung der öffentlichen Medien: Quasi jedes Blatt adelte „Inception“ als großartiges Mindfuckkino zwischen Edelaction und Realitätsphilosophie. Wer nach den Webkommentaren noch immer skeptisch war, kam spätestens durch diverse Filmzeitschriften zum Einlenken. Oder gab dem Drang nach, mitreden zu wollen.
„Inception“ entwickelte sich rasend schnell zum Sommerblockbuster 2010, gab den anderen Großproduktionen keine Chance und stieg mit seinen Einnahmen enorm. Was Christopher Nolan mit „The Dark Knight“ geschaffen hatte, sollte ihm bei der Promotion für „Inception“ gewaltig helfen: Der Brite war jetzt bekannt als Visionär, der dem Blockbuster seine Intelligenz wieder gab, die Unterhaltung aber deshalb nicht nahm. Wer schon im Kino war, leitete seine Begeisterung meist sofort an den nächsten weiter: Es galt ebenso, diesen angeblich sensationellen Endtwist endlich sehen zu können, von dem alle sprachen. Christopher Nolan und sein neuestes Werk waren in aller Munde und Gesprächsthema Nummer 1 – da gab es dieses immer wiederkehrende Motiv des Blockbusters mit Hirn, die Thematik der Innovationen, die quer durch den Film gejagt und fabelhaft visualisiert werden würden und selbstverständlich die Debatte um die verschiedenen Interpretationen. Das Spiel um Realität oder Traum wusste bestens aufzugehen, hitzte es doch die aufregendsten Diskussionen an. Außerdem galt es, „Inception“ zu verstehen: Der Limbus, die Zeitdehnung, die einzelnen Regeln. Nolans spezieller Kosmos war voller faszinierender Ideen, welche die Zuschauer reihenweise in die Kinos lockten. Oder, anders gesagt: Der Hype hat bestens funktioniert.

Doch gelungene Promotion hin oder her: „Inception“ erweist sich, wenn man denn dem Film mal eine differenzierte Betrachtung schenkt, als wahrlich furioser Actionthriller, der zwar nicht zum besten Film aller Zeiten avancieren könnte, aber dennoch Ambitionen auf etliche Preise und vor allem – dies mag sogar die wichtigere Nachricht darstellen – prägend, weil stilbildend, auf spätere Generationen Film sein. Christopher Nolan hat im Laufe der Jahre zu seiner eigenen Art und Weise, sich an filmischen Kontext heranzuwagen, entwickelt und dümpelt nicht wie manch anderer Kollege in den infantilen Gewässern eines nie wirklich ganz abgeschlossenen Bldungskreises herum. Seine Filme sind dynamisch, sparen nicht an gewaltiger Action, finden – gerade in Betracht auf seine neueren Werke – in den Kreisen der finanziell gut ausgerüsteten statt, was diesen wiederum ermöglicht, mit technischen Innovationen zu arbeiten, und weisen moralische, gesellschaftspolitische, psychologische und philosophische Bezüge auf. Dass Nolan trotz allem nicht zum Retter erklärt werden muss, liegt an den immer noch vorhandenen Schwächen in seinen Werken. In „Inception“ bedient sich der Brite dabei mehrerer grundlegender Elemente, die allesamt auf ein Ziel hinauswachsen: Den Zuschauer vor die Leinwand bannen. Nolan inszeniert erlebendes, mitreißendes Kino und bemüht sich, den Betrachter nicht mit unmenschlisch langen Aufnahmen zu malträtieren oder abzustoßen, wie es ein Stanley Kubrick einst fabriziert hat.
Und dennoch ist das Kino des neuen Wunderkinds zwar actionlastig, aber doch nicht von Action dominiert - es gibt ebenso ausschweifende Dialoge wie kräftige Schießereien, emotionale Momente der Trauer wie imposante Autoverfolgungsjagden, kurz: „Inception“ ist Nolan, wie man ihn jetzt gerade definiert. Und eben um dieser Definition ein wenig nachzugehen, muss man die verschiedenen Aspekte einzeln heruspicken und schließlich wieder zusammenfügen, um sie in ihrer Wirkung bestaunen zu können. „Inception“ ist stark emotionalisiert. Der Plot ist gespickt mit dutzenden Szenen, die zum Mitfühlen aufrufen. Der Protagonist Dom Cobb muss mit dem Tod seiner Frau, eigentlich verschuldet durch ihn – was er sich später auch immer wieder zum Vorwurf macht, weshalb er nicht weg kommt, die glücklichen Momente der Vergangenheit immer wieder aufzusuchen -, umgehen, er muss ihn auch verdrängen, um frei zu sein von den Projektionen seiner gestorbenen Frau, die ihm in den Träumen oft begegnen. Im Spiel DiCaprios erkennt man eindeutig das Leiden, welches Cobb zerfrisst. Denn nicht nur, dass seine Frau, die, als sie wieder in der Realität war, in einem weiteren Traum glaubte zu befinden, und deshalb umbrachte, um aus dem angeblichen Traum wieder heraustreten zu können, nun tot ist – er kann auch nicht wieder in die USA einreisen, wo man ihn als Mörder sucht, schließlich hat seine Frau alles unternommen, um ihn nun so dastehen zu lassen. Der einzige Weg, die jetzige Situation zu umschiffen, wäre der Selbstmord Cobbs gewesen, aber den war er nicht bereit, einzugehen.

Viel rührender Stoff also für einen eigentlichen Action-Thriller. Genug eigentlich, um ein gesamtes Drama zu erzählen. Nolan, für den Redundanz sicherlich kein Fremdwort ist, will aber stets so viel wie möglich unter einen Hut packen. Im nolan'schen Kosmos gibt es Jugendlieben, Identitäts- und Ratlosigkeit, Kämpfe um Macht, Vorrangstellung und Ansehen. In „Inception“ wiederum jede Menge scheinbar einwandfreie, hochsterilisierte Action, (pseudo?)philosophische Anleihen und die angesprochenen Emotionalisierung. Nolan schickt Dom Cobb durch ein undurchdringbares Labyrinth an schicksalsschweren Erlebnissen, die seinem sowieso nicht gerade ermutigenden Leben, in dem er sich wohl mehr in den Träumen anderer befindet als seinen eigenen nachgeht, keinen allzu großen Anschub geben, kurz: Der Protagonist leidet seelisch schwer, sein Wunsch, seine Hoffnung, endlich wieder nach Hause gehen können und zumindest seine Kinder, wenn schon nicht seine Frau, wiederzusehen, zwingt ihn also zu seiner Zusage, den finalen Coup zu planen und durchzuführen. Und der Zuschauer, gezwängt in ein enges Korsett aus Trauer und Verzweiflung, muss mitfühlen. Wer das nicht tut, so könnte man interpretieren, für den ist auch das Nolan-Kino an sich nicht geeignet. Denn ohne diese vielen Emotionen wäre „Inception“ nicht der Film, als der er nun bald, nämlich am 3. Dezember, in den Regalen stehen wird: Dann sähe man als Zuschauer einen gefühlslosen, aber trotzdem hoch spannend inszenierten Actionthriller, der mehr auf Shootouts denn auf Mitfühlen setzen und somit die Quintessenz der Filme des Briten vermissen lassen würde.
Denn zwischen Action und Spannung, Dynamik und Ausführungen, braucht der Zuschauer das bindende Glied. Was beim einen der Humor ist – welcher in Nolans Filmen aber auch nie wirklich zu kurz kommt, vor allem „Inception“ glänzt mit subtilen Witzen, die nicht auf Schenkelklopfermanier blamieren -, stellt sich beim Briten als Drama heraus. Mit viel Feingefühl lässt er seine Figuren oft am Grad des zu Ertragenden wandern, in den Abgrund schauen und entweder scheitern – wie Harvey Dent beispielsweise - oder sich doch noch überwinden. Er benutzt die Thematik, um seinen Werken mehr Tiefgang zu verleihen, und, was als deutlich wichtiger angesehen werden kann, um den Zuschauer förmlich in die Geschichten zu ziehen. Denn mit Emotionen kommt Mitgefühl – und dieses bindet den Betrachter an die einzelnen Charaktere. Was natürlich aber nur funktioniert, wenn der Regisseur mit dem dafür nötigen Können an die Sache herantritt. Nolan, inzwischen darauf spezialisiert, tut dies.

Die Story von „Inception“ besitzt Zug. Sie arbeitet konsequent auf das Ziel zu, schlägt zur Seite aus, liefert Nebenstränge, hat aber doch stets das Ziel im Visier. Nolan führt ein, erklärt die Regeln, weiht die Charaktere ein, schildert seine Welt und lässt den Zuschauer nach und nach eintauchen. Cobb bekommt das Angebot, nimmt es an und beginnt mit der Rekrutierung seiner neuen Teammitglieder, plant die Einpflanzung des Gedankens, bastelt an den verschiedenen Ebenen herum, erklärt der Extraktion fremden jungen Architektin Ariadne die Welt, erzählt ihr von sich und seinem Trauma, nimmt sie sogar mit auf seine Vergangenheitsbewältigung, die in Wahrheit nur ein Nicht-vergessen-können ist, steigt mit der Zeit die Stufen zum Traum hinauf. Mit der Zeit wächst die Vorbereitung, mit der Zeit wächst die Story: Christopher Nolans Stringenz, die trotz aller Rückblicke, Verflechtungen und Einschübe als solche zu bezeichnen ist, beeindruckt - der Regisseur versteht es, den Stein ins Rollen zu bringen, aber der Stein gerät nicht außer Kontrolle. Mit notwendigem Timing für die stillen, herausgegriffenen Momente treibt er seine Geschichte voran, verzichtet nicht auf die komplettierenden Zusätze, verliert den roten Faden aber auch nie aus den Augen. Sicher führt er den Zuschauer durch ein anfangs unüberschaubares Wirrwarr an Haupt- und Nebensträngen, sinnvollen und sinnlosen Ergänzungen, zum Verständnis enorm wichtige Informationen über Abläufe, Definitionen und Gesetze in der Traumwelt.
Auch filmisch arbeitet er konsequent auf das Ende hin: Er lässt den Zeitraffer einsetzen, dadurch einen Sog entstehen, liefert passende Musik und trimmt auch die Schauspieler auf konzentriert. Das Team recherchiert und überlegt, übt mit Trainingsschauplätzen, Ariadne übt, wie man die vier Ebenen am besten designt, der Chemiker berechnet, wie stark oder wie schwach bestimmte Tränke sein müssen. Nolans Spannungsbogen überschreitet den eines gängigen, konventionellen Thrillers in Hollywood heutzutage. Vielmehr besteht die Spannung nicht aus einem spektakulären Kampf, sondern dem hypnotischen Darauf-zu-gehen. Dabei hat er genügend Zeit, um sich den Figuren an sich stärker zu widmen – beispielsweise wird Cobb in der Vorbereitung spezieller begutachtet, man erfährt, gerade weil er Ariadne so manches über seine Vergangenheit erzählt, viel von der Person, von dem introvertierten Teamleiter. Er berichtet von dem traumatischen Ereignis, dem Suizid seiner Frau, von Nolan gelungen, wenn vielleicht auch etwas zu sehr ins Kitschige abdriftend, in Szene gesetzt, betritt mit Ariadne zusammen das Haus, in dem er und seine Frau früher lebten. Er kommt nicht weg von seinem Schock, und dies könnte der gesamten Gruppe zum Verhängnis werden: Schon bei der ersten Extraktion im Film kam es zum ungewollten Fehler, weil Cobb seine Frau projizierte und diese den Plan, der fast vollendet schien, durcheinander brachte.

Hierbei setzt Nolan ganz auf das bewährte Prinzip des Rückblicks, welches er, mit dem Traumschema blendend verpackt, narrativ gut einzubinden weiß. Er fügt seinem Protagonisten diese Trauer zu, um ihn für den Zuschauer begreiflicher, fassbarer zu machen. Ob man dies nun als geschickte Manipulation oder doch filmisch einwandfreie Regisseursfreiheit bezeichnen möchte, bleibt einem jeden offen. Zu konstatieren ist jedoch, dass Nolans Trick funktioniert: Die Geschichte weiß erstmalig wirklich zu fesseln, nachdem der erste Teil eigentlich nur für das Erklären zuständig war, was sich wiederum aufgrund der komplexen Thematik ein wenig in die Länge zog, und der Zuschauer sieht nicht nur mit den Regeln überforderte, sondern jetzt auch in die Story eingebundene Betrachter, die „Inception“ nun auch endlich begeistern kann. Und wenn „Inception“ auf die letzten Meter eines nicht ganz mit Hochgeschwindigkeit ausgeführten Sprints gelangt, die Vorbereitung ab- und die Schläuche anschließt, in den Traum – oder genauer: in die Träume – hinein gleitet und seine vorher nur stückchenweise angerissene Welt in aller Faszination offenbart, gerät alles bis dahin gesehene aus den Fugen. Hier sind dann, ganz im Gegensatz zu den hochgepushten Lobesgesänge auf den überragenden Intellekt des Films, die Superlative auch wirklich angebracht. Was Christopher Nolan visuell aus „Inception“ herausholt, trotzt jeder Kritik. Da werden in der Filmhistorie sicher noch des Öfteren zitierte Hotelflure gedreht, weil sich ein in der davor liegenden Traumebene befindendes Auto quasi gravitationslos durch die Luft geschleudert wird, leblose Körper aneinander geschnürt und in ein außer Kraft gesetztes Fahrstuhlsystem verfrachtet, wo die weitere Bewegung mit außergewöhnlichen Mitteln herbeigerufen werden muss, kurz: Es gibt keine kreativen Grenzen mehr.
Denn, so viel sei offen dargelegt: Nolan muss sich schon seit dem vielversprechenden, aber doch mit noch einigen drastischen Schwachpunkten bestückten „Batman Begins“, der ganz den Erwartungen gemäß den Einspielergebnissen entsprach, vor keinem Studioboss mehr rechtfertigen. Nolan ist nicht nur einer der wenigen Lichtblicke im momentanen Hollywood, er ist auch finanziell gesehen der, den die Unternehmen haben wollen. Seine Filme sind keine den normalen Filmfan abweisende Arthousekunst, sondern auch bestens unterhaltende Actionkracher – Blockbuster mit Hirn. Und eben die sind es dann auch, denen man gewisse Privilegien gönnt. Nolan ist ein ausdrucksstarker Name in der Filmindustrie, ohne den hätte er seinen „Inception“ wohl nie finanziert bekommen. Weil es nun aber so ist, wie es nun mal ist, stehen hinter dem Briten eine ganze Menge zahlungskräftige Leute – und die scheuen sich auch nicht, in manch bizarre Idee einige Millionen zu stecken. Mag heißen: „Inception“ ist grandios visualisiert worden, verfügt über außerordentlich originelle Einfälle und sieht – weil diese mit dem nötigen Budget daherkommen – auch dementsprechend fantastisch aus.

In der Welt eines Christopher Nolan gibt es keine Kompromisse mehr. Man stelle sich das einfach mal so vor: Da spaziert ein junger, energischer Regisseur mit ziemlich abstrakten Ideen in ein Studio und stellt sein Konzept vor. Das ist an sich nicht schlecht, wartet aber mit krassen Vorschlägen auf – eine Straße in Paris, die urplötzlich aufgefaltet wird? Wilde Ballereien in wilden Schneelandschaften mit wilden Fahrzeugen? Mit viel Risiko würde man da spielen, diesem jungen Kerl knappe 160 Millionen und einen Cast, von dem man als Neuling nur träumen kann, einfach so zur Seite zu stellen. Nolan hat die nötigen Voraussetzungen dabei – und bekommt selbst die krasse Traumspielerei auf die Leinwand. So teuer wie geschätzte 30 Independentprojekte zusammen ist „Inception“, und man merkt, dass nicht gespart wurde. Unterlegt von Hans Zimmers in diesem Fall sogar passenden, weil extrem druckvollen Soundtrack ist die Audioanlage kurz davor, zu bersten, wenn unter donnerndem Getöse gigantische Türme in verschneiten Berglandschaften einstürzen und man das Geschehen aus ultraweiter Kameraperspektive beobachten darf. Hypnotisierend ist das fast schon, was dem Filmfan da an cineastischer Haute Cuisine geboten wird, ein einziger großer Leckerbissen ist „Inception“. Züge rasen in Autostaus, es gibt fetzige Ballereien auf dem altmodischen, aber noch immer bestens aussehenden Prinzip der hollywood'schen Carchase, die Nolan rasant, laut inszeniert und vor allem allem zeitlich genau abstimmt. Sobald „Inception“ in den Bereich des Showdowns gelangt, lässt Nolan alle Mängel ob einer strapazierenden Dehnung und Streckung, die schlichtweg langweilend wirkt, hinter sich und konzentriert sich auf das Wesentliche: die Action. Getrauert werden darf davor und richtig los philosophiert werden danach, ganz am Ende – während des fulminanten Finales wird weder emotionalisiert noch groß über realitätstheoretische Fragen nach gedacht, es wird geschossen.
Hier gelangt „Inception“ auch zu seinen Heist-Movie-Anleihen. Idee, Planung, Ausführung: Die drei Grundthemen des Genres sind enthalten, und nur um für Nolan typische Elemente erweitert worden. Man wagt sich jetzt immer weiter an das vorher als unmöglich deklarierte Ziel heran: Die Inception. Doch genauso gilt: Was vorher durch strukturierte Überlegung war, muss in der Praxis auch erst einmal funktionieren. Schließlich wird nicht ein für Cobb schon zum Routinefall verkommener Standard-, sondern ein hochkomplexer Spezialauftrag ausgeführt. Und dieser gestaltet sich im Traum dann auch schwieriger als vorher gedacht. Das präzise Timing ist eben doch nicht alles und mit urplötzlich auftretenden Zwischenfällen muss gerechnet werden. Und während das Team mit Ausfällen, Verletzten und sonstigen Querelen zu kämpfen hat, beginnt Nolans beste Arbeit am Werk erst wirklich: Das Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Ebenen ist ein Anwärter auf gesamte Jahreskategorien, die es sich zur Aufgabe machen, die besten Szenen des vergangenen Kinokalenders zu küren. Und die perfekte Schnittarbeit, das ausbalancierte Zeitgefühl und die brillant eingefangenen Momente – schwebendes Auto, Bündel regungsloser Körper inmitten eines Fahrstuhlschachts – sind auf dem besten Weg, jene Momente aus „Inception“ auf den Thron zu heben. Dafür ist das ganze Konzept einfach viel zu beeindruckend, als das ein anderer, bloß „normaler“ Streifen dies toppen könnte, sollte man meinen.

Ein Glück, dass „Inception“ hierbei auf ein gelungenes, wenn auch nicht sensationelles Drehbuch – wie es „The Dark Knight“ mit seinen an „Fight Club“ erinnernden Zitaten des Jokers besaß - setzen kann. Dieses nämlich schafft es, die abschließende Wendung vom furiosen Actionthriller-Heist-Movie-Science-Fiction-Blockbuster durchdacht, logisch und nicht konfus und hanebüchen erscheinen zu lassen. Denn der Twist kommt spät, reichlich spät, aber nicht zu spät, sondern genau richtig – nämlich als letztes Bild, als letzte Einstellung. Und um die erhoffte Wirkung auch zu erreichen, muss die Schlusswendung auch mit Klasse daherkommen, darf sich nicht in die Reihe der pseudounerwarteten Idiotentwists einreihen. Doch wenn man „Inception“ einmal gesehen hat, kann man sich gar nichts anderes mehr vorstellen – schlichtweg unpassend, aufgesetzt würde das aussehen. Nolan hat mit dem Ende seine Vision der Traumwelt, sein ganzes, komplexes, Werk abgeschlossen – den Gedankengang des Zuschauers aber eben noch lange nicht. Es ist also insofern ein großer Verdienst, mit anzusehen, wie man nach dem Film noch lange über mögliche Interpretationen diskutiert. „Inception“ bezieht seine Faszination nicht allein aus dem Begeisterungsfaktor, der durch unzählige geniale Momente evoziert wird – dazu besitzt der Film auch zu viele eklatante Schwächen, die nicht als Marginalien durchgehen: Zu lang, dabei teilweise extrem, das ab und zu einsetzende Sich-wiederholen bei der Geschichte um den Tod von Cobbs Frau, der manchmal einsetzende Effekt, sich quasi selbst bestaunen zu wollen, ohne wirklich abzuwarten, ob dies bei den Zuschauern genauso ist -, sondern vor allem durch die direkt erfolgende Einbindung des Betrachters in die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten und somit in den Film.
Die ganze Arbeit überlässt Nolan dem Zuschauer aber nicht – etwas muss vorgegeben sein, damit man nachziehen kann. Und Nolan hat sich Gedanken gemacht. Zum Beispiel stellt „Inception“ den Traum zeitweise als Realitätsflucht dar: Für Cobb, der darin Heil sucht, aber auch droht, sich darin zu verlieren, ist der Traum sozusagen seine zweite Heimat geworden. Denn diese kann er wesentlich beeinflussen, er kann sie sich bauen und zurechtlegen, formen und bilden, bevor er darin auf Suche geht. Der Traum ist eine Art Zufluchtsort, in ihm muss man sich vor fast keinen Konsequenzen schützen, der Traum ist anziehend und abstoßend zugleich. Es geht Nolan nicht nur um das Frage nach der eindeutig definierbaren Realität, sondern ebenso um die vorhandene Faszination Traum. Und er spielt mit ihr so, wie es den Zuschauer am meisten beeindrucken könnte. Er stellt ihn als interessante, aber auch gefährliche Nutzungsmöglichkeit hin und romantisiert ihn gewissermaßen. Bevor er sich der oft gestellten Frage annehmen kann, muss er ihn auch erklären – und somit eventuell auch ein Bild davon zeichnen.

Nolans „Inception“ - was ist das also? Ein Kritikerliebling gewiss, ein Medienspektakel ebenso, ein klar durch kalkuliertes Event von Film, das mit Bezügen zur Realitätsfrage aufwartet und Effekte aufzuweisen hat, die nicht nur bloß knallen, sondern auch kreativ sind. Auch ist „Inception“ Christopher Nolans neuester Entwicklungsstand, und man kann froh sein, dass es Regisseure gibt, die ihn wenigen Werken so extrem viel dazu lernen und ihr Wissen dann auch so konkret zu verpacken im Stande sind. Vielleicht ist „Inception“ eine Offenbarung, vielleicht nicht – was aber fest steht, ist: Nolan zeigt uns den Film von morgen. Willkommen im Blockbuster 2.0.